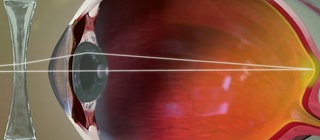Themen
- Sehen
- Sehsinn
- Auge
- Linsenauge
Fächer
- Biologie
Klassenstufen
- ab Klasse 5, alle Schularten



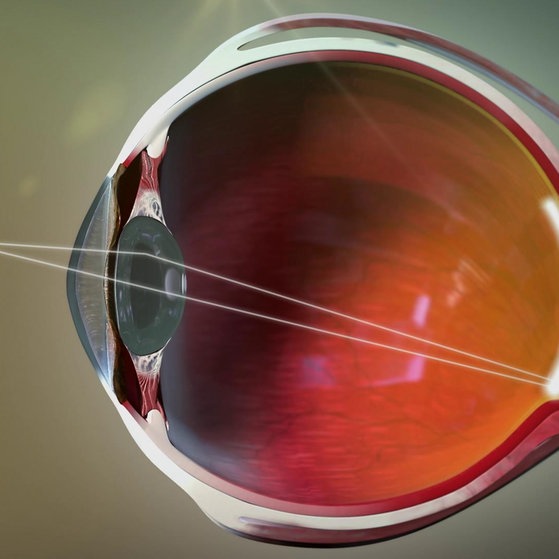
Methodisch-didaktische Hinweise
Bezug zu den Bildungsplänen
Die Bildungspläne weisen zur Thematik rund ums Auge für die Klassen 7/8/9 der Sekundarstufe I folgende inhaltsbezogenen Kompetenzen aus:
Informationssysteme:
„Die Schülerinnen und Schüler kennen Sinnesorgane des Menschen und ihre Bedeutung für die Informationsaufnahme aus Umwelt und eigenem Körper. Am Beispiel Auge können sie Zusammenhänge zwischen Struktur und Funktion erklären, Fehlsichtigkeiten beschreiben und Korrekturmöglichkeiten begründen.“
Konkretisiert wird dies wie folgt: „Die Schülerinnen und Schüler können den Bau des Auges beschreiben, die Funktion der Bestandteile erklären und dessen Leistungen und Grenzen untersuchen.“
Die zugeordneten prozessbezogenen Kompetenzen lauten beispielweise: „Erkenntnisgewinnung“:
Die Schülerinnen und Schüler können:
- biologische Arbeitstechniken anwenden
- Morphologie und Anatomie von Lebewesen und Organen untersuchen
- Experimente planen, durchführen und auswerten
- Fragestellungen und begründete Vermutungen zu biologischen Phänomenen formulieren
- Beobachtungen und Versuche durchführen und auswerten
- Hypothesen formulieren und zur Überprüfung geeignete Experimente planen
- aus Versuchsergebnissen allgemeine Aussagen ableiten
- mit Modellen arbeiten
- Struktur- und Funktionsmodelle zur Veranschaulichung anwenden
Kommunikation: Die Schülerinnen und Schüler können:
- Informationen beschaffen und aufarbeiten
- Informationen aus Texten, Bildern, Tabellen, Diagrammen oder Grafiken entnehmen
- biologische Sachverhalte unter Verwendung der Fachsprache beschreiben oder erklären
- Zusammenhänge zwischen Alltagssituationen und biologischen
- Sachverhalten herstellen und dabei bewusst die Fachsprache verwenden
- den Verlauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit dokumentieren
Bewertung: Die Schülerinnen und Schüler können:
- in ihrer Lebenswelt biologische Sachverhalte erkennen
- Bezüge zu anderen Unterrichtsfächern herstellen*
*in diesem Fall zum Fach Physik, wo folgende inhaltsbezogene Kompetenz ebenfalls für die Jahrgangsstufen 7/8/9 der Sekundarstufe I genannt wird: „Die Schülerinnen und Schüler können optische und akustische Phänomene experimentell untersuchen. Sie trennen zunehmend zwischen ihrer Wahrnehmung und deren physikalischer Beschreibung.“
Die genannten Kompetenzen werden innerhalb der unten beschriebenen Einheit angebahnt und mittels der Sendung ‚total phänomenal – Superaugen‘ abgerundet.
Beschreibung des Unterrichtsablaufs / Hinweise für Lehrkräfte
Das Auge ist ein wunderbares und komplexes Organ und bietet nicht nur deshalb sehr viele Möglichkeiten, stark handlungsorientiert zu arbeiten. Außerdem liefert der Film ‚Superaugen‘ eine Fülle von Informationen, die umso nachhaltiger von den Schüler:innen erfasst werden können, je besser sie sich im Voraus angeeignet wurden.
Aus diesem Grund wird an dieser Stelle eine drei- bis vierstündige Kompakteinheit zur Thematik beschrieben, die je nach schulischen beziehungsweise organisatorischen Voraussetzungen am Stück, zum Beispiel innerhalb einer Organisationseinheit an einem Schulvor- oder -nachmittag, durchgeführt werden oder in entsprechende 45-minütige Einzelstunden zerlegt werden kann.
1. Stunde
1. Versuch: Beim ersten Versuch sollte zunächst an die Klasse appelliert werden, sich sehr diszipliniert zu verhalten, da der Klassenraum am Anfang völlig abgedunkel t wird. An jeweils zwei Schüler:innen wird umgedreht eine Formen-und-Farben-Karte (Größe DIN A4) verteilt. Danach wird der Versuch wie auf dem Versuchsblatt 1 beschrieben durchgeführt.
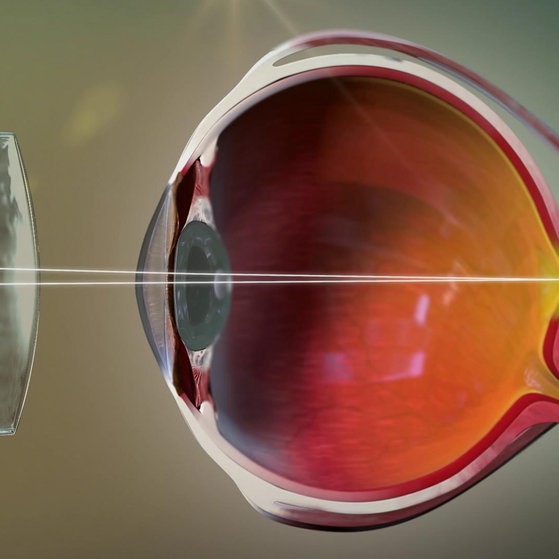
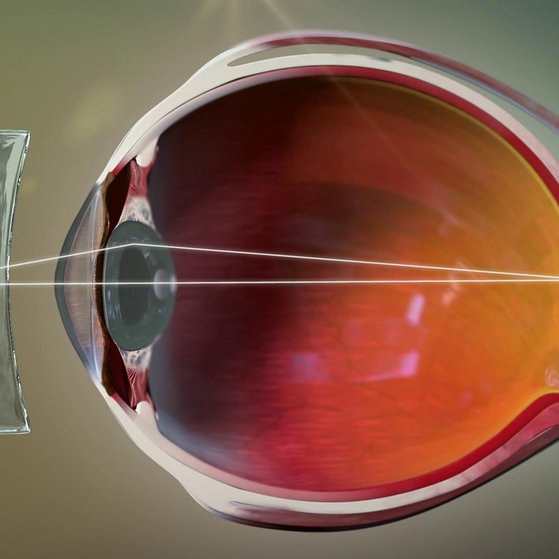
Das anschließende Klassengespräch sammelt die Beobachtungen der Schüler:innen und mündet in die wissenschaftliche Erklärung der Beobachtungen (= lediglich die Wahrnehmung von Formen – diese in Grau- beziehungsweise Schwarz-Weiß-Tönen – bei schwachem Lichteinfall sowie die deutliche Farbwahrnehmung im hellen Raum).
Anschließend wird das Versuchsblatt 1 ausgeteilt, in Einzel- oder Partnerarbeit ausgefüllt und anschließend besprochen.
2. Versuch: Der zweite Versuch wird nicht im Klassenverband, sondern in Partnerarbeit ausgeführt. Es geht nochmals um Farbwahrnehmung, wobei nun die Anordnung der im 1. Versuch „entdeckten“ Lichtsinneszellen im Auge im Vordergrund steht. Das entsprechende Versuchsblatt 2 wird an die jeweiligen Partner-Teams verteilt, daraufhin können diese den Anordnungen folgend alleine weiterarbeiten.
Nach etwa zehn Minuten findet die Besprechung der Ergebnisse im Plenum statt.
3. Versuch: Auch der dritte Versuch, der dem räumlichen Sehen dient, kann auf gleiche Weise ein- und durchgeführt werden: Die Schüler:innen arbeiten selbstständig, zunächst im Zweierteam, dann im Einzelversuch gemäß der Anweisungen des Versuchsblattes 3 – dieses wird sofort verteilt – und füllen es entsprechend ihrer Wahrnehmung und ihres Erkenntnisgewinns aus.
Auch daraufhin folgt ein erläuterndes Gespräch in der Klasse.
Allgemein gilt, dass die vorgeschlagenen und besprochenen Lösungen am Ende des Unterrichts zusätzlich ausgehängt werden können.
2. und 3. Stunde
Nun wird auf die Lerntheke verwiesen: Insgesamt liegen sechs Arbeitsblätter aus (Arbeitsblatt 1–6), die den Schüler:innen die Möglichkeit bieten, sich eigenständig Wissen rund ums Auge anzueignen. Folgende Inhalte werden dabei vermittelt:

Die Arbeitsblätter werden von der Lehrkraft kurz vorgestellt (Inhalt, Aufgabenformate, mögliche Sozialform), damit den Schüler*innen die Vorauswahl erleichtert wird.
Es gibt mehrere Optionen, diese eher freie Arbeitsform weiterhin zu steuern:
- Man erklärt bestimmte Blätter zu Pflichtaufgaben (zum Beispiel die Arbeitsblätter 3 und 5, da diese unmittelbar an die Versuchsergebnisse anknüpfen) und lässt die Schüler*innen aus den anderen frei auswählen.
- Man gibt einen Pflichtanteil vor (zum Beispiel mindestens drei oder vier Aufgaben sind zu bearbeiten), lässt den Schüler:innen diesbezüglich jedoch freie Auswahl. Weitere Arbeitsblätter können freiwillig und je nach Interesse genommen werden.
- Die ganz freie Variante ohne Vorgabe bestimmter Inhalte oder einer Mindestanzahl.
In jedem Fall sollten den Schüler*innen zusätzliche Informationsquellen zur Verfügung stehen (Schulbücher, iPads, Internet-Zugang, das eigene SmartPhone zur selbstverantwortlichen Nutzung, …).
Varianten:
Variante 1: Falls die Unterrichtsstunden einzeln gehalten werden (müssen), könnte in der 2. Stunde das kurze Wiederholungsspiel „Tipp oder Topp?“ vorgeschaltet werden, da den Schüler:innen die direkte Anknüpfung an die Versuchsergebnisse fehlt. Dazu steht eine kleine Einstiegsaktivierung zur Verfügung (Infoblatt „Tipp-Topp?“).
Variante 2: Die freie Arbeitsphase kann von circa 90 auf 45 Minuten, also um eine Schulstunde, verkürzt werden. Entsprechend sollten die Vorgaben (siehe Option a. und b.) modifiziert werden.
Auch hier empfiehlt es sich, die Lösungen auszuhängen, um den Schüler:innen eine eigenverantwortliche Überprüfung zu ermöglichen.
4. Stunde
Die letzte Unterrichtsstunde zur Augen-Thematik beginnt mit einem Klassen-Feedback inhaltlicher Natur. An die Tafel wird der Satz „Über das Auge habe ich bisher gelernt: …“ geschrieben. Verschiedene Schüler*innen werden aufgefordert, diesen zu beenden (oder sie melden sich bestenfalls freiwillig). So werden wichtige Fakten wiederholt.
Danach verweist die Lehrkraft auf die zusammenfassende Darstellung, die im nun folgenden Film „Superaugen“ zu sehen sein wird. Außerdem werden weitere, vertiefende Aspekte zum Thema „Auge“ genannt, die darin zur Geltung kommen (zum Beispiel Sehleistungen bei Tieren). Anschließend werden die beiden zum Filminhalt passenden Arbeitsblätter (Arbeitsblatt 7: Superrätsel! und 8: Supertiere!) vorgestellt und den Schüler*innen zur Auswahl gegeben.
Der Film wird eingespielt. Die Schüler:innen benötigen danach noch einige Minuten zur Bearbeitung ihrer Aufgabe. Nachdem diese Korrektur gelesen wurde, kann die kleine Kompakteinheit „Auge“ mit einem Gespräch zu diesen Impulsen enden:
- Was hat euch im Film besonders überrascht?
- Was fandet ihr im Film besonders faszinierend?
- Welchen Versuch, den ihr durchgeführt habt, fandet ihr besonders spannend?
- Was hat euch allgemein zum Thema ‚Auge‘ begeistert?
- Was würde euch zu diesem Thema noch interessieren?
| Stunde | Zeit | Aktivität | Medien |
|---|---|---|---|
| 1 | 45‘ | drei Versuche zur Leistung des Auges: - Hell-Dunkel-Wahrnehmung - Farbwahrnehmung - Räumliches Sehen wissenschaftliches Arbeiten mittels Durchführung, Beobachtung und Erklärung der Versuche | Versuchsblätter 1–3, verschiedene Materialien (siehe Versuchsbeschreibungen, zum Beispiel beiliegende Farbkarte usw.) |
| 2 | 45‘ | ggf. Wiederholungsspiel ‚Tipp oder Topp?‘ Lerntheke zum Thema Auge | Infoblatt “Tipp-Topp?”, Arbeitsblätter 1–6 |
| 3 | 45‘ | Lerntheke zum Thema Auge, Korrektur und Ergänzung der Arbeitsblätter | Arbeitsblätter 1–6 Lösungsblätter |
| 4 | 45‘ | Klassen-Feedback zum Lernstand, Film „Superaugen“ zur Wiederholung, Festigung sowie Vertiefung, Abschluss-Gespräch | Film, Arbeitsblätter 7 + 8 |
Methodische Erläuterungen
Zur 1. Stunde:
Am Beginn der kleinen Kompakteinheit steht die erste Unterrichtssequenz mit drei Versuchen, die die Schüler:innen gleichermaßen überraschen, begeistern, motivieren und für das Thema „Auge“ sensibilisieren sollen. Außerdem geben sie sofort einen inspirierenden Einblick in die total phänomenale Welt des Sehens.
Erfahrungsgemäß gelingt dies mit den beschriebenen Versuchen sehr gut, da die Schüler:innen selbst agieren können und die jeweiligen Effekte „live“ an sich erleben – in den allermeisten Fällen mit unerwarteten und daher überraschenden Wahrnehmungen. Dies gelingt selbst im ersten Versuch, bei dem die gesuchten Formen schon rasch, die Farben erst nach weiterem Lichteinfall erkannt werden können – obwohl die Schüler:innen sicher wissen, dass man in der Nacht beziehungsweise im Dunkeln keine oder zumindest kaum Farben sehen kann. Eine Alltagserfahrung wird hier also exemplarisch genutzt, um einen inspirierenden Effekt zu schaffen.
Auch der nächste Versuch wird sicher sehr gerne durchgeführt: Die Schüler:innen können nun im Partnerteam handeln und dennoch individuelle Erfahrungen machen. Dass Farben randständig nicht wahrgenommen werden, ist in den meist Fällen nicht bewusst und führt hier somit zum zweiten Mal zu einer kleinen Überraschung mit wissenschaftlichem Hintergrund.
Im letzten Versuch geht es unter anderem um das Phänomen räumlichen Sehens. Auch hier werden scheinbar banale Alltagserfahrungen genutzt (zum Beispiel ein Glas füllen), um überraschende Erkenntnisse zu veranschaulichen.
Natürlich sollen die Wahrnehmungen und Ergebnisse der Versuche auch wissenschaftlich ausgewertet werden. Das wiederum geschieht mithilfe der Versuchsprotokolle (Versuchsblätter 1–3) und den entsprechenden Klassengesprächen.
Zu den Stunden 2 und 3:
Die Arbeitsblätter 1–6 decken ein breites inhaltliches Spektrum zum Themenfeld „Auge“ ab.
Die Methode der „Lerntheke“ gestattet den Schüler:innen in Bezug auf die Weiterarbeit und den eigenen Lernzuwachs einige Freiheiten. So entscheiden sie teilweise, womit sie sich inhaltlich auseinandersetzen und können daher eigenen Neigungen und Interessen nachgehen und selbst den Schwierigkeitsgrad ihrer Aufgabe bestimmen (Differenzierung). Und so wird die Motivation durch Autonomie erfahrungsgemäß erhöht. Auch Lerntempo und -partner sollten gerade deshalb selbst gewählt werden können.
Verschiedene Möglichkeiten, diese Arbeitsform zu variieren wurden bereits oben mit den Punkten a.–c. unter ‚Beschreibung des Unterrichtsverlaufs‘ genannt.
Hier sei nochmals auf die Wiederholungsoption verwiesen, falls die Unterrichtsstunden zeitlich getrennt unterrichtet werden (siehe Blatt ‚Tipp-Topp‘). Um an die Lerntheke heranzuführen, erscheint dies unerlässlich. Wichtige Erkenntnisse des vorangegangenen Unterrichts werden leichter erinnert, das Interesse lebt so eher wieder auf und trägt in die bevorstehende Arbeitsphase hinein.
Zur 4. Stunde
Sie beginnt mit einem persönlichen Lernstand-Feedback. Die Schüler:innen sollen rückmelden, was sie bisher über das Auge gelernt haben. Auch dies kann einerseits als eine Art Wiederholung gesehen werden. Zugleich wird für alle an die ganze Bandbreite der zurückliegenden Inhalte angeknüpft. Und nicht zuletzt bildet diese Methode die Brücke zur anstehenden Festigungs- beziehungsweise Vertiefungsphase, in deren Mittelpunkt nun der Film „Superaugen“ steht. Dieser zeigt noch einmal sehr anschaulich die total phänomenalen Fakten rund ums Auge, rund ums Sehen. Vieles davon haben die Schüler:innen in den letzten Stunden erarbeitet, und das zumeist selbst. Anderes ist neu und nicht weniger faszinierend. So wird dem Filmeinsatz in dieser Unterrichtssequenz eine ganz besondere didaktisch-methodische Rolle zugeschrieben.
Und wieder werden die individuellen Interessen der Schüler:innen berücksichtigt. Ihnen wird abschließend erneut die Möglichkeit gewährt, einen eigenen Schwerpunkt mittels der Auswahl eines Arbeitsblattes zu setzen (Arbeitsblatt 7 bietet ein Rätsel, in dem relevante Begriffe wiederholt und somit gefestigt werden; Arbeitsblatt 8 beschäftigt sich vertiefend mit tierischen Seh-Leistungen).
Die Abschlussrunde gibt den Schüler:innen noch einmal die Gelegenheit, eigene Eindrücke zu schildern.