Zecken
Zecken gehören zur Klasse der Milben (Acarida). Diese wiederum gehören zu den Spinnentieren (Arachnida), was auch an den acht Beinen der Adulten erkennbar ist. Sie kommen in Gebieten mit wenigstens 70 Prozent Luftfeuchtigkeit vor. Dieses Mikroklima findet sich vor allem in Flusstälern und in Wäldern mit viel Unterholz und einer ausgeprägten Krautschicht. Oftmals wird bezüglich der Verbreitung der Zecken die 800-m-Obergrenze zitiert. Die Tiere wurden aber bis in eine Höhe von 2000 m nachgewiesen.



Zecken als Krankheitsüberträger
Weltweit sind Zecken als Krankheitsüberträger gefürchtet. Bekannt sind über 50 Krankheitserreger, die übertragen werden. Virale Infekte führen häufig zu Hirnhautentzündungen, die sogar tödlich enden können. Beispiel für einen Virustyp ist neben der FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) die im Bereich der GUS auftretende RSSE (Russian Spring Summer Encephalitis). Auch einige ernsthafte bakterielle Erkrankungen werden übertragen, wie das Q-Fieber und die durch Ehrlichien ausgelösten Ehrlichiosen. Letztere sind Krankheiten, die neben neurologischer Komplikationen häufig mit der Zerstörung von Blutzellen verbunden sind.


In Mitteleuropa haben FSME und die Lyme-Borreliose mit Abstand die größte Bedeutung. Die Erreger dieser Krankheiten kommen nicht flächendeckend vor, sondern nur in sogenannten Endemiegebieten. Diese Gebiete werden entweder durch die Registrierung von klinischen Fällen oder durch die Untersuchung der Zecken auf bestimmte Krankheitserreger oder durch die Ermittlung der Antikörperprävalenz, d.h. durch Ermittlung der gegen bestimmte Infektionserreger gerichtete Antikörper ermittelt.
Die FSME ist in Mittel- und Osteuropa verbreitet. Die deutschen Endemiegebiete befinden sich in erster Linie in Baden-Württemberg und in Bayern. In Baden-Württemberg hat die Erkrankungshäufigkeit im Laufe der 90er Jahre erheblich zugenommen. Traten bis 1990 zwischen 8 und 32 Fälle pro Jahr auf, so sind es seit Mitte der 90er Jahre 100-150 Fälle. Als Grund für diese Zunahme werden die milderen Winter der letzten Jahre vermutet.


Die Lyme-Borreliose tritt in ganz Deutschland in großer Häufigkeit auf. Durch Antikörperprävalenzen bei Waldarbeitern wurde eine Karte der Borreliose-Endemiegebiete von Baden-Württemberg erstellt.

FSME
Krankheitsverlauf
FSME tritt gehäuft im Frühsommer auf, kommt aber von April bis Dezember vor. Erreger ist das FSME-Virus, ein RNA-Virus, welches das Gehirn, bevorzugt den Hirnstamm und die motorischen Nerven befällt. An der Einstichstelle der Zecke infizieren die Viren verschiedene Zellen, u.a. Makrophagen. Durch die Lymphbahnen erfolgt daraufhin ein Transport zu den Lymphknoten, wo eine Virusvermehrung stattfindet. Von hier aus gelangen die Viren durch das Blut in weitere Organe, wie die Leber, und nach Überwindung der Blut-Hirn-Schranke ins ZNS (Zentrale-Nerven-System). Dort findet eine weitere Virusvermehrung statt, die zum Absterben von Nervenzellen führt. Die Krankheitssymptome äußern sich folgendermaßen: Nach der Infektion kommt es entweder sehr schnell oder auch erst nach einigen Wochen zu einer grippeartigen Erkrankung, die von Fieber, Kopf-, Kreuz-, und Gliederschmerzen begleitet sein kann. Diese erste Phase dauert 1-8 Tage. In etwa zwei Dritteln der Fälle ist damit die Krankheit überstanden. In etwa einem Drittel kommt es aber nach einer fieberfreien Phase von bis zu 20 Tagen plötzlich zu heftigen Kopf- und Nackenschmerzen und zu hohem Fieber. In schweren Fällen treten Lähmungen der Gesichtsmuskulatur, der Extremitäten und der inneren Organe auf. Da es keine Bekämpfungsmöglichkeit des Virus gibt, beschränkt sich die Krankheitstherapie auf Symptombekämpfung. Klinisch betreut, erholen sich meist auch Schwerkranke innerhalb von zwei bis drei Wochen. Bei 10% bleiben allerdings Restschäden wie Lähmungen, Kopfschmerzen und Depressionen. Etwa 1-2% überleben die Krankheit nicht.
FSME-Erkrankungen
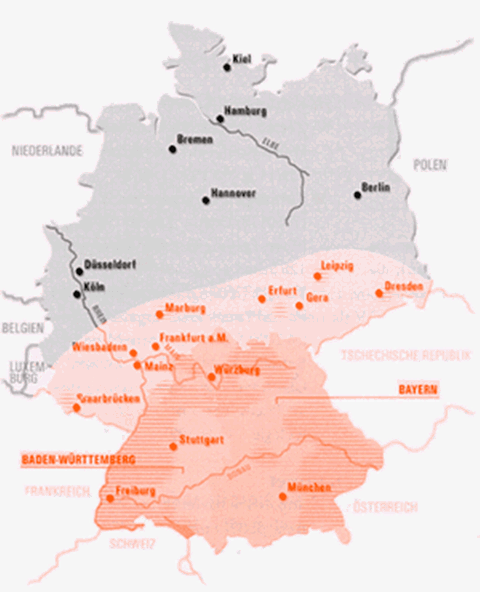
Aktive Immunisierung
Besonders gefährdete Personen in Infektionsgebieten sollten sich gegen FSME impfen lassen. Es gibt zur aktiven Immunisierung Impfstoffe im Handel, die inaktivierte FSME-Viren enthalten. Die Grundimmunisierung besteht aus drei Impfungen, die im 3-Jahres-Rhythmus aufgefrischt werden sollten. Der optimale Impfzeitpunkt liegt in der kalten Jahreszeit, prinzipiell können die Impfungen aber während des ganzen Jahres vorgenommen werden. Die Impfung ist sehr gut verträglich, ernstere Nebenwirkungen (periphere Nervenentzündungen) treten nur mit einer Häufigkeit von 1:1 Mio. auf und sind reversibel. Auch zur passiven Immunisierung existiert ein Impfstoff, der lediglich als kurzfristige Prophylaxe vor Einreise in ein Zeckengebiet bzw. als Sofortmaßnahme nach einem Zeckenstich eingesetzt werden kann. Seine Anwendung ist allerdings mit Gefahren verbunden, da die Antikörper als Fremdeiweiß allergische Reaktionen hervorrufen können. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass die Immunglobulingabe mehr als drei Tage nach dem Stich zu einer Verschlechterung des Infektionsverlaufs führen kann.
Lyme-Borreliose
Krankheitsverlauf
Die weltweit verbreitete Lyme-Borreliose tritt in der Bundesrepublik jährlich mit etwa 100.000 Neuerkrankungen auf und gilt damit als zweithäufigste Infektionskrankheit. Der Erreger ist Borrelia burgdorferi, ein Bakterium aus der Familie der Spirochaetae. Die übertragene Krankheit verläuft meist in drei Phasen. In Stadium I kommt es kurz nach einem Zeckenstich zur Vermehrung und Wanderung der Borrelien. Die einsetzende Immunreaktion des Menschen, bei der Abwehrzellen in die Haut eindringen, äußert sich in einer Hautrötung, die sich ringförmig ausdehnt (Wanderröte). Meist ist dies von grippeähnlichen Symptomen begleitet. Stadium II tritt häufig erst nach Wochen und Monaten ein, wenn sich die Erreger im Körper ausgebreitet haben. Typisch sind Schwindelattacken, neurologische Störungen, Gelenkschmerzen und Herzrhythmusstörungen. In einigen Fällen überleben Borrelien nur an denjenigen Stellen im Körper, die vom Immunsystem schlecht erreicht werden. Sie können in unregelmäßigen Abständen noch Monate bis Jahre nach dem Infektionsbeginn zum Wiederaufflammen der Krankheitssymptome führen (Stadium III). Typisch hierfür sind z.B. "von Gelenk zu Gelenk springende" Entzündungen (sog. Lyme-Arthritis) , Knochenschmerzen und schmerzhafte, chronische Entzündungen peripherer Nerven.


Prophylaxe nach Zeckenstich
Theoretisch ist eine antibiotische Prophylaxe nach jedem Zeckenstich möglich. Hiervon ist aber abzuraten. Sinnvoll ist dagegen die Untersuchung der Zecke auf Borrelien und im positiven Fall eine Antibiotika-Prophylaxe, da nach neueren Untersuchungen 25% der Stiche durch infizierte Zecken zur Übertragung des Erregers führen. Verschiedene Fachlabors führen die Untersuchung der Zecken durch. Die Kosten von mindestens 40 DM müssen selbst getragen werden. Labor-Adressen können bei den Gesundheitsämtern erfragt werden.
Vorbeugung
Prophylaktische Maßnahmen zur Verhinderung von Zeckenstichen haben einen hohen Stellenwert. Bei Aufenthalt in Zeckengebieten sollte dichtschließende Kleidung getragen werden bestehend aus einem langen Hemd und langen Hosen, die in die Socken gesteckt werden. Auch die Verwendung eines Repellents wird empfohlen. Mittel, die auf die Haut aufgetragen werden sind aber nur wenig wirksam. Als äußerst wirksam haben sich Kombinationsprodukte erwiesen, die auf Haut und Kleidung aufgetragen werden. Sie sind rezeptfrei in der Apotheke zu erhalten.

Das Entfernen der Zecke sollte möglichst schnell erfolgen, um den Übertritt von Krankheitserregern in den Wirt zu verhindern. Dabei sei vor der Anwendung von Mitteln wie Uhu, Öl oder Nagellack gewarnt, die das Tier ersticken sollen. Es besteht umso mehr die Gefahr, dass Erreger in die Wirtswunde gelangen, da vermutlich der Speichelfluss angeregt wird. Empfohlen wird, das Tier mit einer sehr feinen Pinzette (Uhrmacherpinzette) möglichst nahe an der Haut zu packen und herauszuziehen. Normale Pinzetten und die im Handel erhältlichen Zeckenzangen sind in der Regel zu grob, da bei ihrem Einsatz der Zeckenkörper gequetscht wird, wobei Erreger in den Wirt übertreten.

Hunde werden häufig von Zecken befallen. Die Weibchen saugen besonders gierig. Sie brauchen viel nahrhaftes Blut, damit sich in ihrem Körper Eier entwicken können. Mehrere Tage wird das Wirtstier zur Ader gelassen. Erst dann zieht das Weibchen seine Mundwerkzeuge aus der Haut und lässt sich abfallen.




