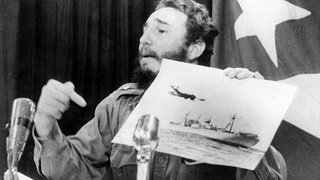Lage von Kuba in Mittelamerika.
SWR - Screenshot aus der Sendung
14. August 2015
20. Juli 2015
Juli 2015
29. Mai 2015
11. April 2015
17. Dezember 2014
April 2009
8. November 2005
1996
1994
1. Juli 1968
9. Oktober 1967
1965
16. Oktober 1964
14. Oktober 1964
August 1964
22. November 1963
10. Oktober 1963
30. August 1963
April 1963
30. Oktober 1962
28. Oktober 1962
27. Oktober 1962
27. Oktober 1962
24. Oktober 1962
22. - 28. Oktober 1962
22. Oktober 1962
16. Oktober 1962
14. Oktober 1962
Anfang Oktober 1962
4. Oktober 1962
Anfang August 1962
10. Juni 1962
Frühjahr 1962
März 1962
Januar 1962
13. August 1961
3. / 4. Juni 1961
17. - 19. April 1961
16. April 1961
20. Januar 1961
3. Januar 1961
Frühjahr / Herbst 1960
4. März 1960
Februar 1960
Mai / Juni 1959
April 1959
Januar 1959
November 1958
27. März 1958
4. Oktober 1957
Dezember 1956
14. Mai 1955
18. Juni 1954
26. Juli 1953
1952
29. August 1949
4. April 1949
1948
6. / 9. August 1945
1934
1933
1920
1902
1899 - 1902
10. Dezember 1898
Sommer 1898
15. Febuar 1898
1895
1886
1868 - 1878
1840
1511