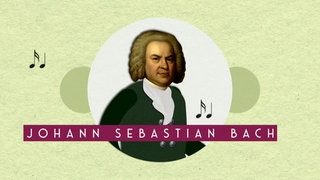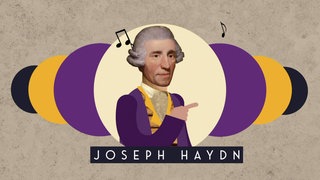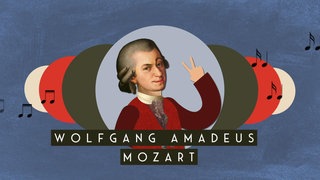Didaktisch-methodische Hinweise
Dauer
Je nach Schwerpunktsetzung 3 bis 4 Schulstunden für alle 5 Arbeitsblätter
Material
Film, Arbeitsblätter, Infoblatt, Lösungsblätter, Papier und Farben (Stifte, Wasserfarben), buntes Papier/Zeitschriften, Auswahl an Instrumenten, die für die Schülerinnen und Schüler (je nach Vorwissen) leicht zu spielen sind.
Binnendifferenzierung
Die Arbeitsblätter bieten eine Auswahl an Aufgaben, die je nach Klassenstufe und Leistungsniveau eingesetzt werden können. Sollen die Schülerinnen und Schüler selbst Musik entwerfen, kann auch dadurch differenziert werden, dass jüngeren oder leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern klarere Vorgaben gegeben werden. Das kann zum Beispiel geschehen durch:
- eine eingegrenzte Auswahl an Instrumenten (z. B. nur zwei sehr unterschiedliche)
- Konzentration nur auf den Rhythmus
- Vorgabe des Tonumfangs (nur 5 oder 3 Töne, die beieinanderliegen oder je einen Ton überspringen, …)
- Vorgabe verschiedener kurzer Melodien, die von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt und verändert/fortgesetzt werden können
Arbeitsblätter 1 und 2 – Joseph Haydn
Sozialformen
Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
Material
Film, Arbeitsblatt 1 und 2, Lösungsblatt 1, Internetzugang
Einstieg
Die Schülerinnen und Schüler schauen den Film und rekapitulieren dessen Inhalt anschließend mit Hilfe eines Suchsels und eines Lückentextes (Arbeitsblatt 1). Bei wenig Zeit können sie den Eindruck, den sie von Haydn gewonnen haben, auch festhalten, indem sie Haydn stichwortartig charakterisieren (Arbeitsblatt 2, Aufgabe 1). Dabei können vor allem seine Liebe zur Musik, sein Humor, und seine Neugier auf Neues (z. B. England) herausgestrichen werden, die im Film anklingen.
Erarbeitung/Ergebnissicherung
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich im Internet einen Überblick darüber, wie die Wiener Sängerknaben und Chormädchen heute leben und tauschen sich darüber aus, ob sie selbst sich so ein Leben vorstellen können (Aufgabe 2). Sie diskutieren, was das Angebot, Mitglied zu werden wohl für den siebenjährigen Haydn bedeutete und halten ihre eigenen Gedanken dazu fest, indem sie einen freundschaftlichen Rat an ihn formulieren (Aufgabe 3). Dabei kann zum einen deutlich werden, dass es für ein Kind nicht nur einfach ist, (allein) in eine fremde Stadt zu ziehen. Zum anderen kann herausgearbeitet werden, dass es eine große Chance für Haydn war, seine Liebe zur Musik leben zu können und vielleicht sogar aus den einfachen Verhältnissen, aus denen er stammte, herauszukommen.
Vertiefung
Zusätzlich können die Schülerinnen und Schüler sich darüber austauschen, welche Hobbys sie so begeistern, dass sie bereit sind (oder wären) freiwillig viel Zeit damit zu verbringen. Anschließend formulieren sie aus Haydns Perspektive einen Rat für Zeiten, in denen sie einmal weniger Lust haben, sich für ihr Hobby anzustrengen (Aufgabe 4). Vor dem Hintergrund der Biografie Haydns könnte zum Beispiel deutlich werden, dass es sich lohnen kann, auch in schwierigen Zeiten einfach dranzubleiben und die Sache dabei nicht verbissen, sondern mit Neugier und Humor anzugehen. So lassen sich Schritt für Schritt Fortschritte erzielen.
Arbeitsblatt 3 – Kaiserhymne
Sozialformen
Unterrichtsgespräch, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
Material
Arbeitsblatt 3, Infoblatt 1, Audio, ggf. eine den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler entsprechende Auswahl an Musikinstrumenten
Einstieg
Die Schülerinnen und Schüler versuchen sich anhand der Originalhandschrift Haydns die Melodie der „Kaiserhymne“ zu erschließen (summend oder mit Instrumenten) und tauschen sich darüber aus, inwiefern diese ihnen bekannt vorkommt (deutsche Nationalhymne) (Aufgabe 1). Damit die Schülerinnen und Schüler noch keine weiteren Hinweise erhalten, bietet es sich an, die Noten zunächst nur auf dem Smartboard zu zeigen.
Erarbeitung 1
Indem sie den Text der Kaiserhymne und der deutschen Nationalhymne miteinander vergleichen, arbeiten die Schülerinnen und Schüler heraus, dass es hier um einen Kaiser und im Text der Nationalhymne um Deutschland geht, die jeweils mit ähnlich pathetischen Worten verehrt werden. Sie informieren sich darüber, was (National-)Hymnen ausmacht und erläutern, inwiefern die beiden Texte dazu passen (Aufgabe 2).
Erarbeitung / Ergebnissicherung 2
Anschließend hören sie sich die Melodie der Hymne an und beschreiben deren Wirkung mit Hilfe von Adjektiven. Unter Zuhilfenahme des Infoblatts 1, halten sie außerdem fest, mit welchen Mitteln diese Wirkung erzeugt wird (Aufgabe 3). Hier ist je nach vorhandenem Audio zu beachten, dass die Version aus dem Kaiserquartett durchaus fröhlichere und verspieltere Elemente enthält als Aufnahmen der deutschen Nationalhymne. Hier böte sich für ältere und oder leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler auch ein Vergleich an. Auch die vier Variationen aus dem Kaiserquartett selbst könnten miteinander verglichen werden. Abschließend erläutern die Schülerinnen und Schüler, inwiefern sie die Auswahl dieses Stücks als Nationalhymne für gelungen und noch immer zeitgemäß halten (Aufgabe 4).
Vertiefung
Vertiefend können sich interessierte Schülerinnen und Schüler darin versuchen, eine eigene kleine Hymne zu verfassen (Aufgabe 5). Dadurch, dass sie sich um einen Alltagsgegenstand drehen soll, kann auf humorvolle Weise besonders deutlich werden, dass es sich bei Hymnen normalerweise um eine recht pathetische Form handelt, die etwas Großes, Idealisiertes loben und ehren soll. Je nach Alter und Fähigkeiten können die Schülerinnen und Schüler dazu auch eine eigene Melodie entwerfen und/oder die Melodie der Kaiserhymne oder anderer ihnen bekannter Stücke übernehmen oder abwandeln.
Arbeitsblatt 4 – Klassik
Sozialformen
Unterrichtsgespräch, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
Material
Arbeitsblatt 4, Lösungsblatt
Erarbeitung/Ergebnissicherung
Dieses Arbeitsblatt richtet sich eher an etwas ältere Schülerinnen und Schüler und bietet Hintergrundinformationen für eine vertieftere Auseinandersetzung mit Arbeitsblatt 5. Die Schülerinnen und Schüler lesen einen kurzen Hintergrundtext zur Musik der Klassik und prüfen ihr Textverständnis mithilfe eines „Rätsels“. Anschließend fassen sie in eigenen Worten zusammen, welche Rolle Wien für die klassische Musik spielte.
Arbeitsblatt 5 – Mit Humor
Sozialformen
Unterrichtsgespräch, Einzelarbeit, Partnerarbeit, ggf. Gruppenarbeit
Material
Arbeitsblatt 5, Infoblatt 1, Audio, ggf. (Bunt-)Stifte und Papier
Einstieg
Die Schülerinnen und Schüler hören sich den zweiten Satz der „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ an und äußern anschließend spontan, was ihnen aufgefallen ist. (Aufgabe 1).
Erarbeitung/Ergebnissicherung 1
Sie lesen einen kurzen Infotext über Humor in der Musik Haydns und erläutern, inwiefern sich auch in dieser Sinfonie Humor versteckt (Kontrast zwischen piano und fortissimo). Zusätzlich können sie Vermutungen darüber anstellen, was Haydn dazu bewegte, diese Überraschung hier einzubauen. Über seine Beweggründe gibt es unterschiedliche Überlieferungen von zeitgenössischen Biografen. Die Schülerinnen und Schüler schauen sich diese an und beurteilen abschließend begründet, welche der beiden ihnen plausibler vorkommt (Aufgabe 2). Dabei kann unter anderem deutlich werden, dass Haydns Humor es nicht unwahrscheinlich macht, dass er Schläfer im Publikum aufwecken wollte. Dass er seinem Schüler etwas entgegensetzen wollte, was im Gedächtnis bleibt, ist jedoch nicht weniger plausibel.
Erarbeitung/Ergebnissicherung 2
Vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler können sich abschließend eine Geschichte zum zweiten Satz überlegen, die zur Musik ablaufen und in der die „Überraschung“ eine Rolle spielen könnte. Steht etwas mehr Zeit zur Verfügung, kann dies auch in Gruppenarbeit mit dem Arbeitsauftrag erfolgen, einen kleinen Sketch zu entwerfen, der zur Musik vorgespielt oder getanzt werden kann (Aufgabe 3). Je Klasse und Gegebenheiten vor Ort können die Schülerinnen und Schüler ihren Sketch anschließend vielleicht sogar im Stil eines Flashmobs in der Schule vorführen. Ältere und/oder leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können sich alternativ noch intensiver damit auseinandersetzen, mit welchen Mitteln die „Überraschung“ überhaupt erzeugt wird (Aufgabe 4) und überlegen abschließend, ob ihnen der Name „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ oder der englische Titel „The Surprise“ passender erscheinen (Aufgabe 5). Dabei kann unter anderem noch einmal zusammengefasst werden, dass es sich ja nicht nur um einen Paukenschlag, sondern um ein Fortissimo des ganzen Orchesters handelt.