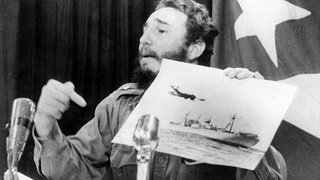Eine Karte des Irak
SWR - Screenshot aus der Sendung
8. Januar 2016
6. Januar 2016
6. Januar 2016
26. November 2015
31. Oktober 2015
11. August 2015
März 2015
1. Dezember 2014
1. September 2014
8. August 2014
29. Juni 2014
10. Juni 2014
30. April 2014
1. Januar 2014
Ende 2013
Juli 2013
23. Juli 2012
14. März 2012
15. Dezember 2011
25. Februar 2011
Januar und Februar 2011
31. Oktober 2010
19. August 2010
1. Juni 2010
14. Oktober 2009
1. Januar 2009
1. September 2008
25. März 2008
1. Februar 2008
16. Dezember 2007
16. September 2007
14. August 2007
7. Juli 2007
3./4. Mai 2007
3. Februar 2007
30. Dezember 2006 Hinrichtung von Ex-Diktator Saddam Hussein . Er wird erhängt.
16. Dezember 2006
5. November 2006
20. Mai 2006
22. Februar 2006
20. Januar 2006
15. Dezember 2005
15. Oktober 2005
30. Januar 2005
28. Juni 2004
Frühjahr 2004
13. Juli 2003
8. April 2003
19. März 2003
5. Februar 2003
11. September 2001 Anschlag auf das World-Trade-Center in New York . Die Bush-Administration sieht die Mitschuld dafür bei den afghanischen Taliban und dem irakischen Regime.
1996 - 2003
April 1991
Ende März 1991
2. / 3. März 1991
28. Februar 1991
17. Januar 1991
2. Aug. 1990
20. August 1988
16. März 1988
1984 - 1988
22. September 1980
16. Juli 1979
1979
1972
17. Juli 1968
8. Februar 1963
7. Oktober 1959
14. Juli 1958
1943
1. April 1941
18. April 1937
3. Oktober 1932
1927
1925
23. August 1921
1920
1918
16. Mai 1916
1915 - 1917