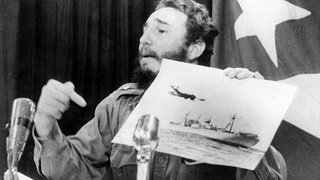Eine Karte von Großbritannien.
SWR - Screenshot aus der Sendung
11. Januar 2016
18. Dezember 2015
10. September 2015
1. Mai 2014
28. Februar 2014
3. Januar 2013
Juni 2012
27. Juni 2012
2. April 2011
15. Juni 2010
5. Februar 2010
24. Mai 2009
9. März 2009
7. März 2009
4. März 2008
31. Mai 2007
8. Mai 2007
7. März 2007
Januar 2007
Oktober 2006
11. – 13. Oktober 2006
März 2006
September 2005
Mai 2005
Oktober 2002
Karfreitag 1998
24. April 1995
31. August 1994
1985
1980 / 81
28. Mai 1974
Am 24. März
30. Januar 1972
6. Febuar 1971
1970
14. August 1969
1967
1956 - 62
18. April 1949
1939 - 45
1937
1926
Juni 1922
6. Dezember 1921
11. Juli 1921
1919 - 21
1919
1918
23. April 1916
1914
1905
1892
1886
1874
1867
1848
1846 - 48
1840
1829
1823
1. Januar 1801
1798
1795
1791
1782
Anfang 17. Jahrhundert
1690
1688
1685
1652
1649
1642
1560
1541
Mitte 15. Jahrhundert
1349 / 50
Anfang 14. Jahrhundert
1171
1168
1014
9. Jahrhundert
ab 6. Jahrhundert
432
ca. 405 n. Chr.
5. Jahrhundert n. Chr.
ab 1200 v. Chr.
ca. 6000 v. Chr.