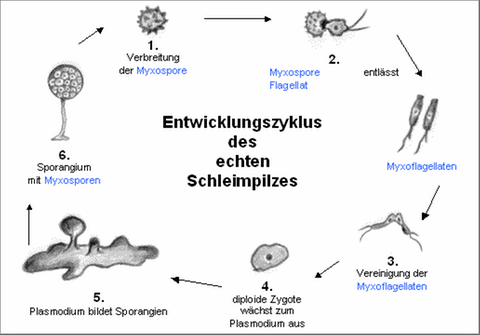Allgemeines über Schleimpilze
In Deutschland landen sie auf der Sondermülldeponie, in Amerika werden sie für außerirdische Eindringlinge gehalten. In Mexiko werden sie gegrillt und als "caca de luna" gegessen. Viele Schleimpilzarten (Myxomyceten) sind auffällig pigmentiert (gelb und orange) und regen durch ihre Erscheinungsform die Phantasie der Menschen an, wie auch die Namen Blutmilchpilz, gelbe Lohblüte oder Drachendreck zeigen.
Man findet sie an den unterschiedlichsten Orten: Im Laub-, Reisig-, Komposthaufen, an Totholz, Rindenmulch, Gras, abgestorbenen Pflanzenteilen und Moos. Verschiedene Arten kommen ausschließlich während der Schneeschmelze im Frühjahr im Gebirge vor.

Für die Artbestimmung, die anhand der Fruchtkörper erfolgt, sowie zu Züchtungszwecken gibt man die Rinde mit Schleimpilzen in ein geschlossenes Gefäß aus Zellstoff. Nach einigen Tagen bis Wochen erscheinen die Fruchtkörper. Hält man die Umgebung feucht, kann man evtl. das Hervorquellen des Schleimpilzes (Plasmodium) beobachten.
Solange Schleimpilze über den Boden kriechen sind sie oft zum verwechseln ähnlich. Erst der Bau der Fruchtkörper verrät, um welche der über tausend Schleimpilzarten es sich handelt
Kennzeichen der Schleimpilze


Die Hauptkennzeichen der echten Schleimpilze (Myxomycota) sind
- eine zellwandlose, vielkernige, amöboid bewegliche Plasmamasse (Plasmodium = hier: eine einzige Zelle mit vielen Zellkernen; das Plasmodium kann beim Schleimpilz Physarum bis zu 80 cm groß werden)
- Vermehrung durch Sporen (Bildung in besonderen Fruchtkörpern; Bestimmung von Schleimpilzen erfolgt über die ausgebildeten Fruchtkörper. Dabei sind die Gesamtform, Farbe, Größe und Beschaffenheit wichtige Bestimmungskriterien)
Durch die Bildung von röhrenartigen Scheingliedern (Pseudopodien) ist der Organismus imstande sich fortzubewegen. Das Plasmodium nimmt oft netzartige Gestalt an, wenn es auf seiner Nahrungssuche über Hindernisse kriecht. Damit wird die Oberfläche vergrößert und der Schleimpilz kann sich beachtlich ausbreiten. Unter dem Mikroskop kann man beobachten, wie das Zytoplasma innerhalb der feinen Kanäle pulsierend hin und her strömt. Man nimmt an, dass diese Strömung bei der Verteilung der Nahrung und des Sauerstoffs behilflich ist. Bei Trockenheit oder Kälte kann sich das Plasmodium zum hornartigen Sklerotium verhärten. In diesem Ruhestadium wartet es dann günstigere Bedingungen ab.
Die Einordnung der Schleimpilze ist sehr schwierig, da sie
- kein Chlorophyll enthalten, mit dem sie wie eine typische Pflanze Energie aus Licht gewinnen, ihre Ernährung ist durchweg heterotroph (= Unterschied zu den typischen Pflanzen)
- sich wie riesige Amöben (= Unterschied zu den Pilzen) bewegen
- sich durch Phagocytose ernähren und
- (einige Schleimpilze) sogar begeiselte Geschlechtszellen bilden
- feste pilzartige Fruchtkörper und Sporen ausbilden, (= Unterschied zu den tierischen Organismen)
Aus heutiger Sicht werden sie als eigenständige, von den Protozoen abstammende, Gruppe betrachtet.
Intelligenztest für Schleimpilze: Die Einzeller finden den kürzesten Weg von A nach B.
Entwicklungszyklus
- Verbreitung der Sporen durch Wind, Wasser oder Tiere
- Bei feuchten Bedingungen platzt die Myxospore auf und entlässt Zellen, die entweder amöboid (Myxoamöben) oder begeiselt (Myxoflagellaten) sind, wobei sich die Formen ineinander umwandeln können (hier nur Flagellat dargestellt).
- Zellen vereinigen sich zu Paaren und bilden
- Diploide Zygoten
- Das Plasmodium (=Fusionsplasmodium) bildet sich durch wiederholte Mitosen des Kerns der Zygote ohne Zytoplasmateilung, sowie durch Fusion mit weiteren Zygoten. Zur Fruchtkörperbildung kriecht ein reifes Plasmodium an trockene und helle Stellen. Es wölben sich Fruchtkörper (Sporangien) auf, die häufig mit einem Fuß und Stiel versehen sind (arttypisch).
- Innerhalb des Sporangiums entstehen durch Meiose zahlreiche haploide Sporen (Myxosporen), die zunächst ein Dauerstadium ausbilden


Entwicklungszyklus des echten Schleimpilzes