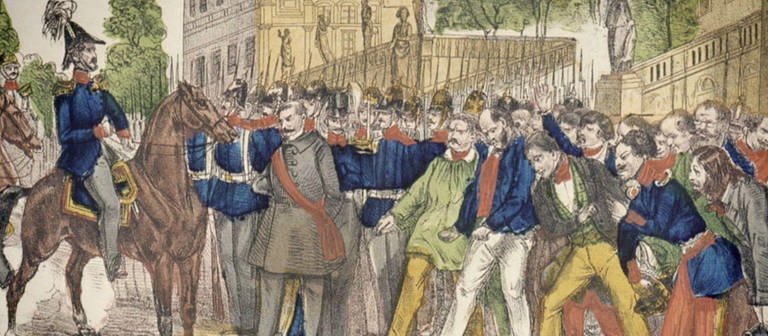Themen
● Französische Revolution
● Napoleon Bonaparte
● Hambacher Fest
● Paulskirche
● Badische Revolution
● 1848
Fächer
● Geschichte
● WZG
Klassenstufen
ab Klasse 6, alle Schularten
Fächeranbindung und Kompetenzen
Die Bildungspläne für das Fach Geschichte sehen die Entwicklung der folgenden fünf Kompetenzfelder vor:
1. Fragekompetenz: Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, selbst Fragen an die Geschichte zu stellen und Wege zu ihrer Beantwortung zu finden.
2. Methodenkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler sollen fachspezifische Methoden anwenden können.
3. Reflexionskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler sollen geschichtliche Sachverhalte und Deutungen analysieren, beurteilen und bewerten können.
4. Orientierungskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler sollen Geschichte als Orientierung nutzen können zum Verständnis der Gegenwart und Zukunft, zum Aufbau ihrer eigenen Identität und zur Begründung gegenwarts- und zukunftsbezogener Handlungen.
5. Sachkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler sollen historische Sachverhalte strukturiert erschließen und wiedergeben können.
Die beschriebene fünfstündige Themeneinheit zum Film „Kampf für die Freiheit“ beinhaltet diesbezüglich Umsetzungsmöglichkeiten für jeden genannten Kompetenzbereich.
Inhaltlich sollen „die Schülerinnen und Schüler […] die Auseinandersetzung um die Gründung freiheitlicher Nationalstaaten im 19. Jahrhundert in Europa analysieren und bewerten“ können. Fachbegriffe, auf die dabei besonderer Wert gelegt wird, sind: napoleonische Flurbereinigung, „Einheit und Freiheit“, Bürgertum, Zensur, Nationalstaat sowie Verfassung: Bürger- und Menschenrechte. Auch dazu eignet sich der Filmeinsatz in ganz besonderer Weise.
Unterrichtsablauf - Stunde I: Die Französische Revolution erreicht den Südwesten

Der Unterricht beginnt mit dem Vorlesen der zehn Richtig-Falsch-Sätze als Wiederholung (Einstiegsblatt I). Anschließend betont die Lehrkraft, dass die Französische Revolution recht schnell Auswirkungen auf das Leben in Südwestdeutschland hatte, wie man im folgenden Filmausschnitt sehen könne. Dann wird der erste Teil von „Kampf für die Freiheit“ bis Minute 5:39 kommentarlos und ohne Aufgabenstellung gezeigt.
Anschließend fassen die Schülerinnen und Schüler in einem Plenumsgespräch ihre Erkenntnisse kurz und recht frei geleitet zusammen. Um die Ergebnisse inhaltlich zu sichern, wird der Ausschnitt ein zweites Mal gezeigt, nun mit der Aufgabe, je eines der differenzierten Arbeitsblätter (Arbeitsblätter 1 G, M, E) auszufüllen.
G = grundlegendes Niveau
M = mittleres Niveau
E = erweitertes Niveau
Die Lehrkraft kann diese bewusst bestimmten Schülerinnen und Schülern zuordnen oder Wahlfreiheit bieten. Danach erfolgt eine Korrekturphase, zum Beispiel durch Aushängen der Lösung(en). Um das neu erworbene Wissen kompetenzorientiert anzuwenden, sollen sich die Jugendlichen daraufhin mit Arbeitsblatt 2 in die Rolle eines Freiheitskämpfers versetzen und einen Tagebucheintrag aus seiner Sicht formulieren. Falls noch Zeit bleibt, können einzelne Einträge in der Klasse vorgelesen werden.
| Zeit | Aktionen | Sozialform | Medien |
|---|---|---|---|
| 5‘ | Lehrkraft: Vorlesen der zehn Aussagen zur Französischen Revolution, Schülerinnen und Schüler beurteilen nach ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ und korrigieren gegebenenfalls | Plenum | I. Einstiegsblatt |
| 10‘ | Überleitung zum Film, zunächst ohne Arbeitsauftrag, und anschließende Besprechung erster Erkenntnisse | Plenum | Filmausschnitt bis Min. 5:39 |
| 10‘ | Zweites Anschauen des Films, individuelles Bearbeiten der Aufgaben (Filminhalt) | Einzelarbeit | I. Arbeitsblatt 1 (drei Versionen: G, M, E) |
| 5‘ | Vervollständigen der Lösungen, Korrekturen, Ergänzungen | Plenum, Einzelarbeit | Lösungsblätter als Aushang |
| 10‘ | Bearbeiten der Identifikationsaufgabe | Einzelarbeit | I. Arbeitsblatt 2 |
| 5‘ | Vorlesen einzelner Tagebucheinträge | Plenum |
Unterrichtsablauf - Stunde II: Napoleon Bonaparte prägt das Land

Mithilfe von vier Screenshots (Einstiegsblatt II) werden die Schülerinnen und Schüler zur Stundeneröffnung an die Ergebnisse des vergangenen Geschichtsunterrichts erinnert. Sie verbalisieren diese und können somit an den Inhalt der bevorstehenden Stunde anknüpfen.
Was Napoleon im Südwesten Deutschlands wirtschaftlich und politisch bewirkte, wird im zweiten Teil des Films „Kampf für die Freiheit“ bis Minute 11:44 gezeigt. Der Klasse wird zuvor differenzierend ein Arbeitsblatt ausgehändigt, welches es ermöglicht, durch Wegstreichen (Arbeitsblatt 3 G und M) beziehungsweise Ergänzen (Arbeitsblatt 3 E) den Inhalt rasch zu erfassen und zu dokumentieren. Anschließend erfolgt die Korrektur.
Im zweiten Teil der Stunde steht die Person Napoleon Bonapartes vertiefend im Mittelpunkt. Das entsprechende Arbeitsblatt 4 bietet einen kurzen Lebenslauf und einen eher affektiven Zugang zu seinen Charaktereigenschaften. Die Klasse benötigt dazu Schulbücher oder Zugang zu Lexika beziehungsweise zum Internet. Es kann in Einzel- oder Partnerarbeit ausgefüllt werden.
Im Abschlussgespräch können folgende Aspekte thematisiert werden: Der Bestand der Veränderungen Napoleons bis heute (Gegenwartsbezug) oder die Einschätzung des Charakters Bonapartes im Vergleich zu seinen Errungenschaften (Werturteil).
| Zeit | Aktionen | Sozialform | Medien |
|---|---|---|---|
| 5‘ | Wiederholung der Inhalte aus der vergangenen Geschichtsstunde mittels vier Screenshots | Plenum | II. Einstiegsblatt |
| 5‘ | Überleitung zum Film, Aufgabenstellung | Plenum | II. Arbeitsblatt 3 (G, M, E) |
| 15‘ | Anschauen des Films, individuelles Bearbeiten der Aufgaben (Filminhalt) | Einzelarbeit | Filmausschnitt bis Min. 11:44 |
| 5‘ | Korrekturlesen, ggf. Besprechung | Plenum | II. Arbeitsblatt 3, Lösungen |
| 10‘ | Überleitung zur Person Napoleon Bonapartes, weitere Aufgabenstellung, Schülerrecherche | Einzelarbeit, Partnerarbeit | II. Arbeitsblatt 4 |
| 5‘ | Abschlussgespräch | Plenum |
Unterrichtsablauf - Stunde III: Konstitutionelle Monarchie in Baden – Mitbestimmung und Zensur

Die dritte Unterrichtsstunde beginnt mit einer leichten Provokation. Napoleons Porträt wird mit den Worten „Fluch oder Segen?“ eingeblendet (Einstiegsblatt III). Die Klasse wird nach einer kurzen Murmelphase, während welcher sich die Schülerinnen und Schüler eindeutig positionieren sollen, zur konträren Stellungnahme aufgefordert. Das Eingangsgespräch endet dann mit dem Hinweis der Lehrkraft, dass die folgenden Ereignisse nur verstanden und nachvollzogen werden können, wenn bestimmte Begriffe vorbereitend geklärt sind. Dazu dient das erste Arbeitsblatt (Arbeitsblatt 5). Es kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden.
Nach der Korrektur sollten die Begriffsdefinitionen klar sein, sodass der dritte Filmausschnitt aus „Kampf für die Freiheit“ bis Minute 16:47 gezeigt werden kann. Ein kurzes, wiederholendes Klassengespräch festigt die dargestellten Inhalte und erleichtert zudem das Begriffsverständnis aufgrund der konkreten Anwendung. Die abschließende Interpretation der Karikatur „Der Denkerclub“, welche im Film zu sehen ist, ermöglicht einen differenzierten Transfer des Gelernten mittels einer weiteren fachspezifischen Arbeitsweise (Arbeitsblätter 6 E, G, M). Die Schülerinnen und Schüler werden so an eine zeitgenössische, authentische Form der politischen Kritik herangeführt. Zuletzt können Stellungnahmen, Kommentare oder Vergleiche mit heute thematisiert im Plenum oder offene Fragen geklärt werden.
| Zeit | Aktionen | Sozialform | Medien |
|---|---|---|---|
| 5‘ | Provokation mittels eines Napoleon-Porträts: Fluch oder Segen? Überleitung zur Begriffsklärung | Partnerarbeit (Murmelphase), Plenum | III. Einstiegsblatt |
| 10‘ | Bearbeitung der Begriffsdefinitionen | Einzelarbeit, Partnerarbeit | III. Arbeitsblatt 5 |
| 10‘ | Überleitung und Anschauen des Filmausschnitts, anschließende Besprechung | Plenum | Filmausschnitt bis Min. 16:47 |
| 15‘ | Interpretation der Karikatur „Der Denkerclub“ | Einzelarbeit | III. Arbeitsblatt 6 (drei Versionen) |
| 5‘ | Abschlussgespräch | Plenum |
Unterrichtsablauf - Stunde IV: Die politische Opposition und das Hambacher Fest

Am Anfang des Geschichtsunterrichts steht zur Aktivierung und Motivation ein Galgenmännle- beziehungsweise Hangman-Spiel. Die Klasse soll die folgenden Begriffe erraten: Holz – Tabak – Wein. In welchen bisherigen Zusammenhang diese zu setzen sind, wird der kommende Filmausschnitt zeigen. Die Lehrkraft weist darauf hin. Die Schülerinnen und Schüler sollen außerdem die allgemeinen Lebensumstände der Menschen im Südwesten beachten sowie deren Reaktion darauf. Dann wird der Ausschnitt von Minute 16:47 – 21:22 gezeigt. Das auswertende Klassengespräch thematisiert …
a. die gezeigten Missstände:
- Verbot, sich Brenn- und Feuerholz zu besorgen
- Steuerlast bezüglich des Wein- und Tabakanbaus
- aus beiden resultierend: Hunger und Armut
→ somit: Anknüpfung an das Eingangsspiel
- allgemeine Unzufriedenheit wegen Bespitzelung, Überwachung und Unfreiheit
b. die Reaktionen der Menschen darauf:
- Auswanderung nach Nord- und Südamerika
- Rückzug ins Private (Biedermeier)
- politisch oppositionelle Aktivität (Widerstand)
Die kursiv gesetzten Schlüsselbegriffe sollten so oder ähnlich genannt und betont werden. Sie tauchen dann bei der sich anschließenden Bearbeitung des Wirkungsschemas (Arbeitsblätter 7 E, G, M) auf. Hier kann differenzierend mit den drei Versionen des Arbeitsauftrages gearbeitet werden. Nach der Überprüfungsphase (Korrekturlesen, Aushang oder Einblenden der Lösung) wird das Hambacher Fest mittels des zweiten Arbeitsblattes (Arbeitsblatt 8) näher betrachtet. Das sinnerfassende Lesen ermöglicht hier die Herausarbeitung der wesentlichen politischen Forderungen von damals: Einigkeit und Recht und Freiheit – sowie den Brückenschlag zum Gegenwartsbezug. Außerdem wird den Schülerinnen und Schülern eine Identifikationsmöglichkeit geboten, indem sie eine mögliche persönliche Handlungsfolge bewerten. Einzelne Schülerinnen und Schüler lesen ihre Entscheidung mit den entsprechenden Begründungen exemplarisch vor.
Die abschließende Kurzanalyse der Rede Siebenpfeiffers (Ausschnitt), der im Filmausschnitt eingeführt wurde, entspricht dem fachspezifischen Prinzip der Quellenarbeit im Geschichtsunterricht. Die Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden.
| Zeit | Aktionen | Sozialform | Medien |
|---|---|---|---|
| 10‘ | Einstiegsspiel ‚Galgenmännle‘ (Holz, Wein, Tabak) und Überleitung zum Filmausschnitt mit Beobachtungsauftrag | Plenum | Tafel |
| 10‘ | Anschauen des Filmausschnitts und anschließende Besprechung | Plenum | Filmausschnitt bis Min. 21:22 |
| 10‘ | Bearbeitung des Wirkungsschemas und Korrektur beziehungsweise Ergänzung (Aufgabe 1) | Einzelarbeit | IV. Arbeitsblatt 7 (drei Versionen) |
| 5‘ | Vorlesen einzelner Schülerentscheidungen mit Begründungen (Aufgabe 2) | Plenum | IV. Arbeitsblatt 7 |
| 10‘ | Weiterarbeit an den politischen Forderungen des Hambacher Festes und der Rede Siebenpfeiffers, gegebenenfalls Korrektur und Ergänzungen | Einzelarbeit, Partnerarbeit | IV. Arbeitsblatt 8 |
Unterrichtsablauf - Stunde V: Die Paulskirche in Frankfurt und die Badische Revolution

Mit dem Einstiegsblatt – am besten schrittweise einblenden – wiederholt die Klasse anfangs Erkenntnisse aus den letzten Unterrichtsstunden. Aus jeweils vier Begriffen soll der unpassende ausgewählt und benannt werden. Das gemeinsame Charakteristikum der drei anderen wird anschließend betont und gegebenenfalls nochmals kurz besprochen. Dadurch wird eine inhaltliche Anknüpfung gewährleistet.
Zu den letzten angesprochenen Begriffen zählt ‚Widerstand‘. Dieser wird als Überleitung zum letzten Filmausschnitt genutzt. Die Lehrkraft weist auf die beiden ‚Widerständler‘ Adam von Itzstein und Friedrich Hecker hin, die – jeder auf unterschiedliche Weise – oppositionell gegen die Macht der Fürsten vorgegangen waren. Mithilfe des Arbeitsblattes 9, welches dann verteilt wird, sollen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Handlungsweisen der beiden Revolutionäre erkennen und anschließend bewerten. Dazu wird der letzte Filmausschnitt (Min. 21:22 – Ende) gezeigt. Nach der Korrektur können die Jugendlichen im Klassengespräch die beiden Vorgehensweisen und Grundhaltungen (politische Arbeit im Parlament – gewaltsamer Umsturzversuch) aus eigener Sicht beurteilen.
Danach wird durch das zweite Arbeitsblatt (Arbeitsblatt 10 E, G, M) die Chronologie des Scheiterns der Revolution wiederholt und ein Gegenwartsbezug mittels der Grundfrage „Was bleibt?“ hergestellt. Somit findet ein zielgerichteter Abschluss der gesamten Einheit statt.
| Zeit | Aktionen | Sozialform | Medien |
|---|---|---|---|
| 10‘ | Einstiegsspiel ‚Mit drei dabei‘ (begründete Begriffsauswahl) und Überleitung zum Filmausschnitt mit Beobachtungsauftrag | Plenum | Overhead-Projektor, Beamer V. Einstiegsblatt |
| 10‘ | Anschauen des Filmausschnitts und Bearbeitung der Aufgabe | Einzelarbeit | V. Arbeitsblatt 9 und Filmausschnitt ab Min. 21:22 – Ende |
| 10‘ | Korrektur, Ergänzung und Nachbesprechung | Plenum | V. Arbeitsblatt 9 |
| 10‘ | Überleitung zur Folgeaufgabe: Scheitern der Revolution und Bearbeitung des Arbeitsblattes | Einzel- oder Partnerarbeit | V. Arbeitsblatt 10 (drei Versionen) |
| 5‘ | Korrektur, Ergänzung und Abschlussgespräch | Plenum |
Methodische Erläuterungen
Die Sendung „Kampf für die Freiheit“ bietet so viele inhaltlich umfassende Aspekte, Identifikationsmöglichkeiten und Bezüge zur Gegenwart, dass es sich empfiehlt, den Film in die fünf vorgeschlagenen Abschnitte zu portionieren. Dadurch hat man als Lehrkraft gleichermaßen die Chance zahlreiche geschichtsdidaktische Prinzipien und fachspezifische Methoden innerhalb einer geschlossenen medienbasierten Einheit zum Einsatz und zur Geltung zu bringen (siehe Methoden-Übersicht). Die Kompetenzorientierung ist ebenfalls gewährleistet (Bezüge siehe oben).
| Stunde | Einstieg | Erarbeitung (Auswahl) | Abschluss | Filmsequenz |
|---|---|---|---|---|
| I | Wiederholung: Bewertung von Inhaltsaussagen (richtig – falsch) | Lückentext | Tagebucheintrag (Identifikation mit einem Revolutionär) | 0:00 – 5:39 |
| II | Wiederholung: Visualisierung mittels Screenshots | Textkorrektur | Werturteil (Charakter Napoleons), Gegenwartsbezug | 5:39 – 11:44 |
| III | Provokation und Bewertung der Leistungen Napoleons | Begriffsdefinitionen | Interpretation einer Karikatur (Kritik an der Fürstenwillkür) | 11:44 – 16:47 |
| IV | Einstiegsspiel: ‚Galgenmännle‘ als Hinführung zu Schlüsselbegriffen | Wirkungsschema | sinnerfassendes Lesen, Quellenarbeit | 16:47 – 21:22 |
| V | Einstiegsspiel: ‚Mit drei dabei‘ als Wiederholung und Hinführung | Chronologisierung | Gegenwartsbezug | 21:11 – 29:39 |